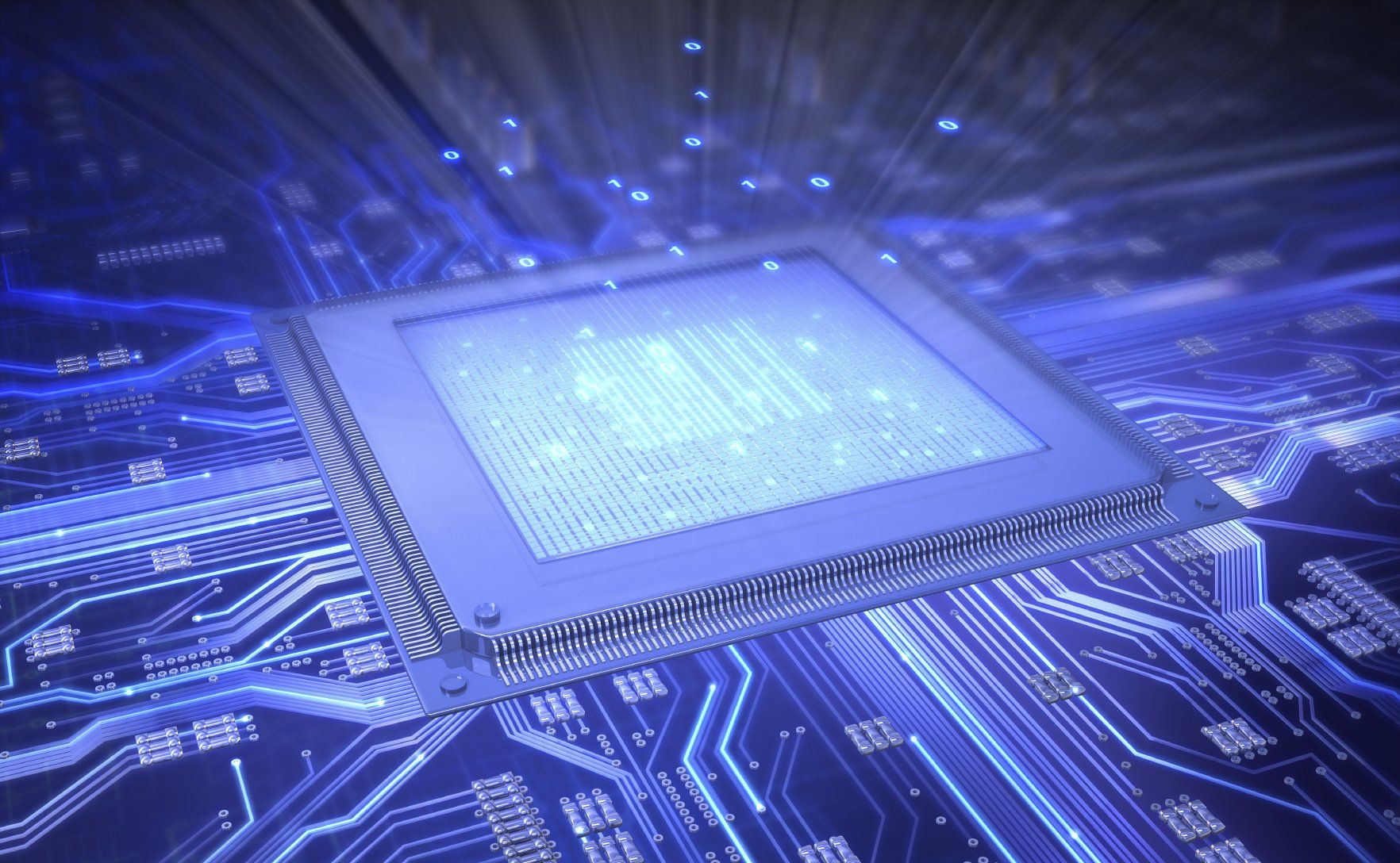Mit Recht gegen Gewalt – Tatort Internet: Cyber-Mobbing
Patricia Hofmann • 11. Mai 2023
Im zweiten Teil der Reihe zum Thema Cybercrime geht es um Cyber-Mobbing und wie dagegen juristisch vorgegangen werden kann. Der erste Teil zum Thema "Sextortion" kann hier nachgelesen werden.
Mia und Sandra sind Teenager, gehen in das gleiche Oberstufengymnasium und waren früher einmal Freundinnen. Eines Tages bekommt Sandra eine Einladung in eine Chat-Nachrichten-Gruppe, Mitglieder der Gruppe sind nahezu sämtliche Schülerinnen und Schüler ihrer Schulstufe. Sandra erkennt sofort, dass das Titelbild ein Foto von ihr ist. Sie ist auf diesem Foto nur in Unterhose bekleidet zu sehen, ihre Brüste sind lediglich von ihren Haaren verdeckt. Sandra muss schnell erkennen, dass Mia diese Gruppe erstellt hat. Aus dem Titel der Gruppe lässt sich schon erahnen, dass Sandra bloßgestellt werden soll. Auch im Chat hat Mia das Foto gepostet und der hinzugefügten Untertitel zum Foto lässt dann keine Interpretation mehr offen: Mia behauptet, dass Sandra ein "abartiges" Sexualleben führe. Es folgen weitere beleidigende Aussagen von Mia, auch andere Gruppenteilnehmer und Gruppenteilnehmerinnen beteiligen sich daran, Sandra schlecht zu machen. Sandra schämt sich, all das ist ihr unangenehm. Sie bleibt dem Unterricht fern, trifft keine Freunde und Freundinnen mehr und zieht sich zurück.
Dies ist nur eines von vielen Beispielen für Cyber-Mobbing. Solche Aktionen oder Äußerungen im Netz sind für Betroffene oft sehr belastend und daher auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit zu verfolgen. Beginnen wir aber nun von vorne und sehen uns an, was es mit dem Begriff des Cyber-Mobbings auf sich hat.
Was ist Cyber-Mobbing?
Unter Cyber-Mobbing versteht man vereinfacht gesagt das bewusste Beleidigen, Belästigen oder Bloßstellen im Internet oder über das Handy, wodurch die Lebensführung der Betroffenen unzumutbar beeinträchtigt wird. Im Strafgesetzbuch heißt das "Fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems". In diesem juristischen Deutsch klingt das natürlich etwas kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn wenn das Gesetz von Handlungen im Wege der Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems spricht, versteht man darunter Handlungen in sozialen Netzwerken, über SMS, E-Mail, Messenger Diensten und so weiter.
Als Deliktsfälle kennt das Cyber-Mobbing zum einen die Verletzung der Ehre und zum anderen das Wahrnehmbar-Machen von Tatsachen oder Bildaufnahmen des höchstpersönlichen Lebensbereichs einer Person ohne deren Zustimmung. Strafbar ist Cyber-Mobbing, wenn eine dieser Handlungen für eine größere Anzahl von Menschen für einen längeren Zeitraum wahrnehmbar ist. Bei der Verletzung der Ehre geht es insbesondere darum, das Ansehen einer Person zu mindern, mit höchstpersönlichem Lebensbereich ist vor allem das Sexualleben, das Familienleben oder Krankheiten gemeint.
Damit kurz zurück zum Anfang: Cyber-Mobbing ist also beispielsweise das Veröffentlichen eines Nacktfotos ohne Zustimmung des Opfers in einer Messenger-Gruppe mit einer größeren Anzahl von Teilnehmern oder in einer Story einer Social Media Plattform.
Strafbar ab dem ersten Posting
Seit 2016 ist "Cyber-Mobbing" strafbar. Mit dem Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz wurde 2021 eine wichtige Änderung in dieser Bestimmung vorgenommen. Bis dahin war eine fortgesetzte Tathandlung erforderlich, mittlerweile kann bereits die einmalige Veröffentlichung beziehungsweise Tathandlung strafrechtlich verfolgt werden. Zusätzlich wurde die Gewährung der psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung um Opfer von Cyber-Mobbing erweitert. Denn auch bei Hass im Netz ist eine Unterstützung der Betroffenen wichtig.
Hilfe bei Cyber-Mobbing
Gerade Jugendliche werden im Internet oft zur Zielscheibe von Cyber-Mobbing. Die Anonymität des Internets lässt die Hemmschwelle sinken. Ist man von Cyber-Mobbing betroffen, kann es sinnvoll sein, darüber zu sprechen. Auch wenn Jugendliche nicht immer Fans ihrer Eltern oder Lehrpersonen sind, sich jemanden anzuvertrauen kann helfen. Das können auch Freunde, Freundinnen oder eine Beratungseinrichtung sein, an die man sich auch anonym wenden kann.
Weiters können die Cyber-Mobbing Aktivitäten beim Dienstanbieter gemeldet werden und ebenso besteht die Möglichkeit diese Nutzer für den eigenen Account zu blockieren. Wichtig ist es – auch für eine etwaige strafrechtliche Verfolgung – die Angriffe zu dokumentieren. Das bedeutet Nachrichten zu speichern oder Screenshots von den Chats beziehungsweise veröffentlichten Bildern anzufertigen.
Oftmals ist es Ziel der Täter oder Täterinnen, die gemobbte Person auszugrenzen. Wenn man also mitbekommt, dass jemand von anderen belästigt wird oder Opfer von Cyber-Mobbing ist, kann die Unterstützung der Betroffenen bereits ein wertvolles Mittel sein. Denn so kann man Betroffenen zeigen, dass sie in dieser Situation nicht allein sind. Gleichzeitig wird das eventuelle Ziel der Täter oder Täterinnen damit oft vereitelt.
Und zum Abschluss nochmals in aller Klarheit: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
Dieser Artikel ist (in ähnlicher Form) bei derStandard.at bereits am 18.04.2023 im Gastblog "Mit Recht gegen Gewalt" von Patricia Hofmann erschienen.
Disclaimer: Wir haben die Recherchen nach unserem besten Wissen und Gewissen durchgeführt, möchten aber klarstellen, dass es sich hierbei um keine Rechtsberatung handelt und wir deshalb auch keine Haftung übernehmen können. Bitte beachten Sie auch, dass die obige Darstellung nicht zwangsläufig auf die individuellen Situationen übertragbar ist. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden im Text hauptsächlich geschlechtsneutrale Formen verwendet. Selbstverständlich gelten sämtliche Personenbezeichnungen gleichermaßen für alle Geschlechter.
Neuer Text